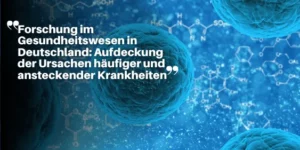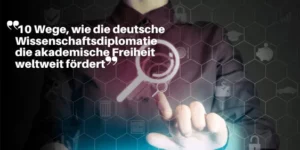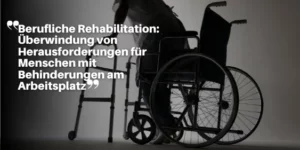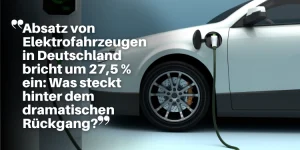Von COVID bis zur psychischen Gesundheit: Warum die Zahl der Krankentage deutscher Arbeitnehmer in die Höhe schießt
Rekordverdächtige Krankenstandsstatistik
Deutschland verzeichnete im Jahr 2023 einen neuen Rekordwert bei der Zahl der Krankheitstage.
Von Januar bis November 2023 waren Arbeitnehmer durchschnittlich 17,7 Tage krankgeschrieben.
Dies stellt einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu den 14,1 Fehltagen vor der Pandemie im Jahr 2019 dar und setzt den kontinuierlichen Aufwärtstrend fort, wobei im Jahr 2021 13,2 Tage gemeldet wurden.
Jährlicher Anstieg des Krankenstands
Die Krankenstände haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Während die Fehltage vor der Pandemie bis 2019 relativ konstant waren, kam es ab dem Jahr 2021 zu einem deutlichen Anstieg der Fehltage.
Im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche Krankheitsdauer bereits 17,4 Tage, ein Trend, der sich im Jahr 2023 fortsetzte und sogar auf 17,7 Tage anstieg.
Dieser kontinuierliche Anstieg zeigt, dass die gesundheitlichen Herausforderungen am Arbeitsplatz zugenommen haben.
 Achten Sie auf Ihre Gesundheit
Achten Sie auf Ihre Gesundheit
Hauptgründe für die steigende Zahl arbeitsfreier Tage
Ein wesentlicher Faktor für diesen dramatischen Anstieg sind Atemwegserkrankungen wie Grippe, Bronchitis und insbesondere COVID-19.
Mittlerweile führen diese Erkrankungen immer häufiger zu längeren Ausfallzeiten, was die Belastung des Gesundheitssystems und der Wirtschaft deutlich verdeutlicht.
Darüber hinaus sind psychische Probleme wie Depressionen und Angststörungen der zweithäufigste Grund für Krankschreibungen.
Auch Muskel-Skelett-Erkrankungen tragen erheblich zur Zahl der Fehltage bei und stehen an dritter Stelle.
Jens Baas, CEO of Techniker Krankenkasse, confirms that these diseases will dominate in 2023.
Verantwortungsvoller Umgang mit Krankheiten
Interessanterweise zeigt eine Umfrage der Techniker Krankenkasse, dass viele Deutsche verantwortungsvoll mit ihren Erkrankungen umgehen.
Sobald die ersten Erkältungssymptome auftreten, meiden 77 % der Befragten soziale Kontakte, um andere Menschen nicht anzustecken.
Ebenso meiden 71 Prozent der Betroffenen belebte Orte, wobei Frauen (74 Prozent) vorsichtiger sind als Männer (67 Prozent).
Ein solches Verhalten lässt darauf schließen, dass viele Menschen weiterhin an den während der Pandemie erlernten Vorsichtsmaßnahmen festhalten.
Diese ständige Wachsamkeit trägt wahrscheinlich dazu bei, die Ausbreitung von Krankheiten zu verlangsamen.
Laufende Schutzmaßnahmen vor der Pandemie
Viele Vorsichtsmaßnahmen aus der Zeit der COVID-19-Pandemie werden im Krankheitsfall auch heute noch angewendet.
So informieren 43 Prozent der Befragten in der Regel auch andere Menschen, mit denen sie bisher Kontakt hatten, über ihre Erkrankung.
Interessanterweise ist diese Praxis mit 50 % besonders weit verbreitet bei der jüngeren Bevölkerung, vor allem bei den unter 40-Jährigen.
Darüber hinaus tragen 29 % der Befragten auch im Krankheitsfall weiterhin eine Maske, was darauf schließen lässt, dass ihnen die Sorge um den Schutz der öffentlichen Gesundheit weiterhin am Herzen liegt.
Der kontinuierliche Anstieg der Krankheitstage in Deutschland hat erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitswelt und das Gesundheitssystem, weshalb ein genauerer Blick auf die Ursachen und anhaltenden Verhaltensänderungen nach der Pandemie wichtig ist.
Hauptursachen für Abwesenheit
Atemwegserkrankungen
Atemwegserkrankungen sind für die Mehrzahl der Arbeitsausfalltage deutscher Arbeitnehmer verantwortlich.
Zu den Hauptursachen zählen Grippe, Bronchitis und nach wie vor COVID-19.
Diese Erkrankungen haben maßgeblich zum Anstieg der Krankheitstage in den letzten Jahren beigetragen.
Vor allem COVID-19 hatte seit 2020 massive Auswirkungen und ließ die Zahl der Krankheitstage deutlich ansteigen.
Einer der Gründe für diesen Anstieg könnte die größere Anfälligkeit sein, die durch die Arbeit in Innenräumen und den regelmäßigen Kontakt mit anderen Menschen entsteht.
Darüber hinaus hat die Pandemie eine neue Dynamik bei der Ausbreitung von Krankheiten mit sich gebracht und viele Menschen bleiben weiterhin vorsichtig und melden sich bei den ersten Symptomen krank.
psychische Erkrankungen
Psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen sind nach Atemwegserkrankungen der zweithäufigste Grund für Arbeitsausfälle.
Die Corona-Pandemie hat die psychische Gesundheit vieler Menschen verschlechtert.
Isolation, Ungewissheit und der Anpassungsdruck an neue Arbeitsweisen haben die psychische Belastung deutlich erhöht.
Auch wenn die Pandemie in vielen Teilen der Welt als beendet gilt, kämpfen zahlreiche Menschen immer noch mit den Langzeitfolgen.
Arbeitgeber sind mehr denn je gefordert, Programme zur Unterstützung der mentalen Gesundheit bereitzustellen und ein achtsames Arbeitsumfeld zu schaffen.
Muskel-Skeletterkrankungen
Muskel-Skeletterkrankungen sind die dritthäufigste Ursache für Arbeitsausfälle.
Diese Erkrankungen betreffen meist den Rücken, die Nackenregion und die Gelenke.
Ursachen dafür können repetitive Bewegungen, schweres Heben oder langes Sitzen am Arbeitsplatz sein.
Gerade in den letzten Jahren, in denen viele Menschen von zu Hause aus arbeiten, hat sich das Problem verstärkt.
Ungeeignete Arbeitsplätze und mangelnde Bewegung haben dazu geführt, dass Rücken- und Nackenschmerzen zugenommen haben.
Es ist wichtig, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen auf ergonomische Arbeitsplätze und regelmäßige Bewegung achten, um langfristigen Schäden vorzubeugen.
Die allgemeinen Ursachen für Arbeitsausfälle haben sich also im Laufe der Zeit kaum verändert, aber die Intensität und die langfristigen Auswirkungen der Pandemie haben deutliche Spuren hinterlassen.
Ein sinnvoller Übergang von akuten zu langfristigen Präventionsmaßnahmen ist daher essentiell, um die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen.
Verhaltensänderungen nach der Pandemie
Die Pandemie hat nicht nur die Frequenz der Krankmeldungen beeinflusst, sondern auch das Verhalten der Menschen im Umgang mit Krankheit verändert.
Eine bundesweite Befragung im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt, wie sich das Bewusstsein für Krankheitsprävention nachhaltig verändert hat.
Hier ein Überblick über die wichtigsten Verhaltensänderungen:
Vermeidung sozialer Kontakte
Sobald die ersten Symptome einer Erkältung auftreten, zeigen die meisten Menschen ein verantwortungsbewusstes Verhalten.
Laut der Befragung vermeiden 77% der Befragten soziale Kontakte, sobald sie Anzeichen einer Erkältung wie Kopf- und Halsschmerzen oder Schnupfen verspüren.
Diese Maßnahme dient nicht nur dem eigenen Wohlbefinden, sondern auch dem Schutz der Mitmenschen.
Durch die Vermeidung enger sozialer Interaktionen reduzieren sie das Risiko, andere anzustecken.
Meidung von Menschenmengen
Mit dem Bewusstsein für die Übertragung von Krankheiten meiden 71% der Befragten nach Möglichkeit überfüllte Orte, wenn sie krank sind.
Diese Vorsichtsmaßnahme wird in der Regel stärker von Frauen (74%) als von Männern (67%) beachtet.
Diese Verhaltensmuster spiegeln das erhöhte Gesundheitsbewusstsein wider, das während der Pandemiezeit angestoßen wurde und nun auch in der gegenwärtigen Krankheitsbewältigung Anwendung findet.
Geschlechtsspezifische Unterschiede
Ein bemerkenswerter Aspekt der Umfrage sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Verhaltensweisen.
Frauen achten tendenziell mehr auf präventive Maßnahmen, wenn sie sich unwohl fühlen. 74% der Frauen, im Vergleich zu 67% der Männer, vermeiden aktiv Menschenmengen, wenn sie sich krank fühlen.
Diese Unterschiede könnten auf verschiedene Faktoren wie sozialisierte Unterschiede in der Fürsorge und Wahrnehmung von Krankheit zurückzuführen sein.
Das anhaltende Bewusstsein und die Vorsicht im Umgang mit Krankheitssymptomen haben das Potenzial, die Verbreitung von Erkrankungen einzudämmen und den allgemeinen Gesundheitszustand zu verbessern.
Diese anhaltenden Verhaltensänderungen sind ein direktes Ergebnis der Erfahrungen während der Pandemie.
Der nächste interessante Punkt in der Diskussion betrifft die dauerhaften COVID-19 Präventionsmaßnahmen, die ebenfalls zu einer Verringerung der Krankheitsübertragung beitragen können.
Dauerhafte COVID-19-Präventionsmaßnahmen
Kommunikationsverhalten bei Krankheit
Die Pandemie hat nicht nur unser Bewusstsein für persönliche Hygiene und Gesundheit gestärkt, sondern auch nachhaltige Verhaltensänderungen in der Kommunikation während einer Erkrankung bewirkt.
Laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse (TK) informieren heute noch 43% der Befragten ihre Kontakte über ihre Erkrankung, wenn sie krank sind.
Dies zeigt, dass ein signifikantes Verantwortungsbewusstsein, das während der Pandemie entstanden ist, weiterhin besteht.
Besonders bemerkenswert ist hier die jüngere Bevölkerung: Unter den 40-Jährigen ist fast jeder Zweite bereit, anderen Bescheid zu geben, wenn Symptome einer Erkältung auftreten.
Diese Entwicklung unterstreicht den Trend zu mehr Offenheit und einer stärkeren Rücksichtnahme auf die Mitmenschen, was langfristig dazu beitragen kann, Infektionsketten zu unterbrechen.
Maskentragen im Krankheitsfall
Ein weiteres interessantes Detail der Umfrage ist das Maskentragen im Krankheitsfall.
Ganze 29% der Befragten gaben an, auch nach Pandemiezeiten noch Masken zu tragen, wenn sie krank sind.
Dies mag zwar nach einem relativ kleinen Prozentsatz klingen, jedoch zeigt es, dass beinahe ein Drittel der Bevölkerung die Maskenpflicht verinnerlicht hat und weiterhin freiwillig anwendet, wenn sie ansteckend sind.
Masken bieten einen effektiven Schutz vor der Verbreitung von Viren und könnten somit zu einer geringeren Krankheitsrate und reduzierter Ansteckung anderer führen.
Diese Praxis hat eindeutig ein hohes Potenzial zur Bekämpfung von Atemwegserkrankungen wie Grippe und Erkältungen.
Altersabhängige Präventivmaßnahmen
Spannend ist in diesem Zusammenhang auch der Altersunterschied in den Schutzeinflüssen und der Kommunikation über Krankheiten.
Jüngere Personengruppen, insbesondere unter 40 Jahren, haben sich als besonders konsistent in der Umsetzung präventiver Maßnahmen erwiesen.
Der Ansatz, dass jüngere Generationen diese Praktiken eher annehmen und fortsetzen, mag mit einem stärkeren Bewusstsein für soziale Verantwortung und moderneren Kommunikationsgewohnheiten, wie z.B. über soziale Medien, zusammenhängen.
Diese Verhaltensmuster setzen ein positives Signal in der Bevölkerung und könnten langfristig zur breiteren Akzeptanz und Einhaltung von gesundheitsbezogenen Richtlinien führen.
This practically implementable form of protective and communication behavior contributes to general health promotion and prevention.
Die Entwicklung dieser langfristigen Präventionspraktiken lässt darauf schließen, dass die Gesellschaft auch nach der Pandemie geschlossen und umsichtig bleiben wird, um die Gesundheit zu schützen und die Zahl der Krankheitstage weiter zu reduzieren.