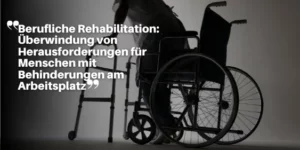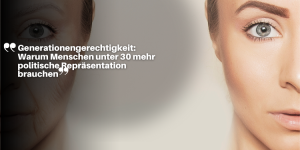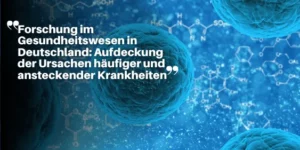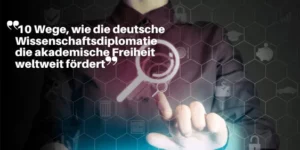Studie zeigt: 79,5 % der jungen Deutschen arbeiten – Aufdeckung von Stereotypen über die Generation Z
Aktuelle Erkenntnisse zur Erwerbsbeteiligung junger Menschen
Die Erwerbsbeteiligung der 20- bis 24-Jährigen in Deutschland ist auf beeindruckende 79,5 Prozent gestiegen.
Damit erreicht sie ein Niveau, das zuletzt in den 1990er Jahren beobachtet wurde.
Dies zeigt eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB).
Grundlage der Untersuchung sind Daten des Mikrozensus, der Bundesagentur für Arbeit sowie der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes.
Diese Datenanalysen fokussieren sich auf Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Betrachtet man isoliert den Mikrozensus, lag die Erwerbsbeteiligung junger Menschen bei rund 76 Prozent.
Die positive Entwicklung wird somit durch eine breite Datenbasis untermauert und zeigt einen klaren Trend: Junge Menschen sind zunehmend im Arbeitsmarkt aktiv und widersetzen sich damit dem oft geäußerten Vorurteil der „arbeitsscheuen Generation Z“.
Ein historischer Vergleich
| 📌 Aspekt | 📋 Beschreibung |
|---|---|
| 📈 Anstieg der Erwerbsbeteiligung | Die Erwerbsbeteiligung der 20- bis 24-Jährigen hat wieder das Niveau der 1990er Jahre erreicht. |
| 🏭 Arbeitsmarkt der 1990er Jahre | Hohe Nachfrage nach jungen Arbeitskräften und geringe Jugendarbeitslosigkeit prägten die damalige Zeit. |
| 📊 Forschungsergebnisse | IAB-Forscher betonen, dass zuletzt Mitte der 1990er Jahre ein vergleichbar hoher Anteil junger Menschen erwerbstätig war. |
Methodische Besonderheiten der Studie
Es ist außerdem interessant zu beachten, dass einige methodische Änderungen in der Erfassung der Erwerbsbeteiligung zu berücksichtigen sind.
Vor 1996 wurden beispielsweise auch Personen, die nicht sofort für den Arbeitsmarkt verfügbar waren, in die Erwerbsquote eingerechnet.
Diese werden heute separat als „Stille Reserve“ aufgeführt.
Dieses Detail könnte darauf hindeuten, dass die heutige Erwerbsquote junger Menschen im historischen Vergleich sogar noch unterschätzt sein könnte.

Steigende Erwerbsbeteiligung von Studierenden und Nichtstudierenden
Auffällig ist auch, dass die Erwerbsbeteiligung sowohl unter Studierenden als auch unter Nichtstudierenden gestiegen ist.
Während die Erwerbsquote unter Studierenden zwischen 2015 und 2023 um 19,3 Prozentpunkte auf 56 Prozent zugenommen hat, stieg die Quote unter Nichtstudierenden um 1,6 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent.
Diese Entwicklung unterstreicht den wachsenden Arbeitsfleiß der jungen Generation und widerspricht den gängigen Stereotypen.
Fazit
Die Zahlen belegen eine deutliche Trendwende: Junge Menschen in Deutschland sind heute so stark in den Arbeitsmarkt eingebunden wie lange nicht mehr.
Sie zeigen Engagement und Einsatzbereitschaft, die ihre hohe Arbeitsmoral unterstreichen.
Ein tieferer Blick in die Daten und die methodischen Erfassungen liefert wichtige Einsichten in die sich wandelnden Arbeitswelten und das Engagement der Generation Z.
Studierende als treibende Kraft
Der aktuelle Anstieg der Erwerbsbeteiligung bei jungen Menschen wird maßgeblich von Studierenden vorangetrieben.
Die Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt, dass 56 Prozent der Studierenden einem Nebenjob nachgehen.
Seit 2015 ist die Erwerbsquote unter Studierenden im Alter von 20 bis 24 Jahren um beeindruckende 19,3 Prozentpunkte gestiegen.
Diese Zunahme ist ein klares Zeichen dafür, dass Studierende neben ihren akademischen Verpflichtungen vermehrt Arbeitsmarktaktivitäten nachgehen.
Steigende Erwerbsbeteiligung
Die deutliche Zunahme der Erwerbsbeteiligung unter Studierenden lässt sich mehrere Gründen zuschreiben.
Einerseits sind die gestiegenen Lebenshaltungskosten ein wesentlicher Faktor, der viele Studierende dazu zwingt, eine Nebentätigkeit aufzunehmen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Andererseits bietet die zunehmende Flexibilität im Arbeitsmarkt, wie etwa durch digitale Plattformen und flexible Arbeitszeiten, Studierenden die Möglichkeit, Arbeit und Studium besser zu vereinen.
Vergleich zu Nichtstudierenden
Auch bei Nichtstudierenden in der gleichen Altersgruppe ist die Erwerbsbeteiligung gestiegen, jedoch in geringerem Maße.
Die Beschäftigungsquote der Nichtstudierenden stieg seit 2015 um 1,6 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent.
Dieser Anstieg zeigt, dass auch junge Menschen außerhalb des akademischen Sektors verstärkt am Arbeitsmarkt beteiligt sind.
Dennoch ist der Zuwachs hier geringer im Vergleich zu Studierenden, was die besondere Rolle der letzteren Gruppe als treibende Kraft hervorhebt.
Bedeutung im größeren Kontext
Die gestiegene Erwerbsbeteiligung unter Studierenden hat weitreichende Implikationen für die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt.
Sie fordert eine Neubewertung der klassischen Vorurteile gegenüber der Generation Z, die häufig als arbeitsscheu abgestempelt wird.
Die erhobenen Daten sprechen jedoch eine deutliche Sprache: Die jungen Menschen von heute zeigen ein bemerkenswertes Arbeitsengagement und eine starke Arbeitsmoral.
Diese Entwicklungen sind nicht nur für die betroffenen Individuen von Bedeutung, sondern auch für Arbeitgeber und Politik, die die Rahmenbedingungen schaffen müssen, um das Potenzial dieser engagierten jungen Menschen voll auszuschöpfen.
Angesichts dieser Erkenntnisse lohnt es sich, die methodischen Besonderheiten der zugrunde liegenden Studie genauer unter die Lupe zu nehmen, um zu verstehen, wie diese beeindruckenden Zahlen ermittelt wurden.
Widerlegung der Generation Z Vorurteile
Zahlen sprechen für sich
Ein weit verbreitetes Vorurteil besagt, dass die Generation Z arbeitsscheu sei und lediglich hohe Ansprüche stelle, ohne die entsprechende Arbeitsmoral nachzuweisen.
Diese Ansicht wird durch aktuelle Studienergebnisse jedoch klar widerlegt.
Wie die Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt, haben junge Menschen zwischen 20 und 24 Jahren eine Erwerbsbeteiligung von 79,5 Prozent erreicht – ein Niveau, das zuletzt in den 1990er Jahren beobachtet wurde.
Diese Ergebnisse basieren auf Daten des Mikrozensus und der Bundesagentur für Arbeit, die sich speziell auf deutsche Staatsbürger konzentrieren.
Arbeitsfreude der jungen Generation
Enzo Weber, Forschungsbereichsleiter beim IAB, betont: “Dass die Generation Z viel fordert, aber wenig arbeitet, ist ein verbreitetes Vorurteil.
Doch es ist falsch.
Die jungen Leute sind fleißig wie lange nicht mehr.
” Diese Aussage wird durch die Zahlen eindrucksvoll untermauert.
Insbesondere die wachsende Erwerbsbeteiligung unter Studierenden zeigt, dass junge Menschen im Alter von 20 bis 24 Jahren überdurchschnittlich engagiert sind.
Allein in dieser Gruppe ist die Erwerbsquote seit 2015 um beachtliche 19,3 Prozentpunkte auf 56 Prozent gestiegen.
Hohe Arbeitsmoral auch bei Nichtstudierenden
Auch bei Nichtstudierenden dieser Altersklasse ist ein Anstieg zu verzeichnen. Die Erwerbsquote stieg hier um 1,6 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent.
Dies zeigt, dass nicht nur Studierende, sondern auch Nichtstudierende eine hohe Arbeitsmoral an den Tag legen.
Die Beteiligung junger Menschen am Arbeitsmarkt ist also in nahezu allen Bereichen auf einem hohen Niveau.
Eine neue Einordnung der ‘Stillen Reserve’
Hinzu kommt, dass die Studie eine methodische Besonderheit berücksichtigt: Seit 1996 wird die ‘Stille Reserve’ – Personen, die zwar erwerbslos sind, aber nicht unmittelbar auf Arbeitssuche – separat erfasst.
Vorher wurden diese Zahlen in die Erwerbsquote eingerechnet.
Diese neue statistische Erfassung könnte teilweise erklären, warum die aktuellen Werte im historischen Vergleich sogar unterschätzt sein könnten.
Junge Menschen erweisen sich somit als engagierte und arbeitsfreudige Mitglieder der Gesellschaft, wodurch das altbekannte Klischee der arbeitsunwilligen Generation Z eindeutig widerlegt wird.
Methodische Besonderheiten der Studie
Fokussierung auf Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit
Die betreffende Studie legt den Fokus ausschließlich auf Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Diese Methodik hilft, Verzerrungen durch unterschiedliche Arbeitsmärkte und Bildungssysteme innerhalb der Altersgruppe von 20- bis 24-Jährigen auszuschließen.
Dieser Umstand erlaubt es, präzisere Aussagen über die Erwerbsbeteiligung und die Entwicklungen innerhalb Deutschlands zu treffen, basierend auf homogenen Datenquellen.
Unterschiedliche Berechnungsmethoden
Die Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) haben verschiedene Berechnungsmethoden angewandt, die zu einem Anstieg der Erwerbsbeteiligung um 5 bis 6 Prozent führten.
Diese Unterschiede in den Berechnungen zeigen, dass die methodische Durchführung einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse haben kann.
Die Schätzungen deuten darauf hin, dass der Anteil der arbeitenden jungen Menschen zuletzt Mitte der 1990er Jahre ähnlich hoch war.
Statistische Erfassung der „Stillen Reserve“
Eine wesentliche methodische Neuerung seit 1996 ist die separate Erfassung der sogenannten „Stillen Reserve“.
Unter „Stiller Reserve“ versteht man Personen, die arbeitslos sind, aber nicht aktiv auf Arbeitssuche gehen.
Vor diesem Stichtag wurden sie in der allgemeinen Erwerbsquote mitgezählt.
Ihre separate Erfassung seit 1996 könnte zur Folge haben, dass die Erwerbsquote der jungen Menschen historisch im Vergleich unterbewertet war.
Dies zeigt, dass die heutige statistische Methodik ein differenzierteres Bild des Arbeitsmarktes liefert und dazu beiträgt, Missverständnisse über die Erwerbsbereitschaft der jungen Generation zu vermeiden.
Abschließend lässt sich feststellen, dass die modernen statistischen Methoden maßgeblich dazu beitragen, ein klareres und realistischeres Bild der Arbeitsmoral junger Menschen zu vermitteln.
Indem sie Mythen entkräften, zeigen die Daten, dass die junge Generation engagiert und bereit ist, sich aktiv am Erwerbsleben zu beteiligen.
Dieses Stereotyp ist immer noch weit verbreitet, wie im folgenden Video zu sehen ist: